„Warum sollte ich überhaupt Latein lernen, wenn es doch von allen Texten Übersetzungen gibt?“
Diese Frage hat jeder, der mit Latein zu tun hat, schon mal gehört, wenn nicht gar sich selbst gestellt. Wozu soll ich mir die Mühe geben, eine (angeblich sogar besonders schwierige) Sprache zu lernen, um mühsam alte Texte zu entziffern, für die bereits mehrere Übersetzungen in allen möglichen Sprachen vorliegen?
Lesen Sie auch: Werde ich jemals Originaltexte mühelos lesen können?
Ich zeige Ihnen heute ein paar Textbeispiele, anhand derer klar wird, was alles im Prozess der Übersetzung verloren gehen kann, denn zwischen Ausgangs- und Zieltext entstehen gezwungenermaßen Diskrepanzen.
Eins möchte ich vorwegnehmen: Ich habe u.a. Übersetzung und Dolmetschen studiert und nehme regelmäßig Übersetzungsaufträge an. Ich kann Ihnen sagen, dass ich keinen professionellen Übersetzer kenne, der literarische Übersetzungen liest oder synchronisierte Filme und Serien anschaut, wenn er das vermeiden kann! Schauen wir uns also an, warum dem so ist.
Scheinbare Wortentsprechungen
Tisch heißt table, Katze heißt cat, Buch heißt book. Easy-peasy!
Gerade wenn wir eine neue Sprache lernen, verleiten uns die vereinfachten Darstellungen zweisprachiger Glossare dazu, zu glauben, dass für ein Wort in einem Sprachsystem einfach eine Entsprechung in einem anderen Sprachsystem existiert.
Das täuscht.
Das Bedeutungsspektrum von den meisten Wörtern ist in der Regel komplex. Wenn wir ein Wörterbuch durchblättern, stellen wir schnell fest, dass die meisten Lemmata polysem sind, d.h. sie haben in verschiedene Geltungsbereiche und Denotationen gegliederte Bedeutungsangaben. Dass sich diese komplexen Bedeutungsspektren bei zwei Lexemen zweier Sprachsysteme genau überlappen, ist beinahe unmöglich. Das führt mit sich, dass sich die meisten Äquivalente schnell als Teiläquivalente entpuppen.
Wenn wir dt. Blatt auf Latein sagen wollen, müssen wir beispielsweise zwischen dem Blatt einer Pflanze (folium) und einem Blatt zum Schreiben (pagina) unterscheiden. Was sich ein Römer unter einer pagina vorstellt, wird außerdem kulturell bedingt etwas anderes sein als das, woran wir heute denken.
Gerade fürs Lateinische ist es in vielen Fällen nicht zielführend, mit Wortentsprechungen zu arbeiten. Viel wichtiger ist es, nach und nach zu verstehen, wie sich das Bedeutungsspektrum eines Lemmas ergeben hat, als einzelne Teiläquivalente kontextlos auswendig zu lernen. Nehmen wir als Beispiel gravis: Wenn der Lerner Teiläquivalente aus dem Glossar lernen muss, wird es etwa Folgendes zu memorieren versuchen:
gravis, e: schwer, lästig, hart, wichtig, streng, würdevoll, heftig
Bitte was? Wer soll sich das denn merken? Das ist eine völlig willkürliche, kontextlose Aneinanderreihung von Wörtern, die kaum etwas gemeinsam zu haben scheinen. Ist das ist einfach nur verwirrend? Wer kennt nicht die (völlig gerechtfertigten) Klagen von Schülern nicht, die vor solchen Bedeutungslisten nur noch den Kopf schütteln?
Da helfen keine Äquivalente, sondern man muss nach und nach lernen, wie sich das Bedeutungsspektrum erweitert hat: Gravis heißt im eigentlichen Sinne ’schwer‘; das, was schwer ist, ist auch ‚bedrückend‘ und daher ‚lästig‘; metaphorisch steht schwer (wie im Deutschen) auch für ’schwierig‘, ‚hart‘; wenn wir sagen, dass ein Mensch schwierig, schwer zu ertragen ist, ist er entweder ‚lästig‘ oder ’streng‘; wenn etwas Gewicht hat, ist es ‚gewichtig‘, also ‚bedeutsam‘, ‚wichtig‘; trifft uns etwas schwer zu, ist das ‚heftig‘; usw. Ausgehend zunächst von der konkreten Bedeutung können wir anhand einer extensiven Lektüre nach und nach alle Denotationen des Wortes aufdecken. Wenn man dieses Prinzip anhand vieler Wörter erfahren hat, wird sich auch Vieles von alleine beim Lesen erschließen. Das ist viel wichtiger, als eine Entsprechung wählen zu wollen, weil es in den meisten Kontexten so ist, dass wir zwischen der einen und der anderen Bedeutungsnuance nicht haarscharf unterscheiden können, sondern ein nicht diskret unterscheidbares semantisches Spektrum eine Rolle spielt.
Wenn wir also eine Übersetzung lesen, haben wir nicht mehr das komplexe Spektrum mit all seinen möglichen Interpretationsmöglichkeiten, sondern der Übersetzer hat schon eine Wahl treffen müssen und liefert uns gezwungenermaßen eine abgespeckte Version des Textes oder eine Version, die gar ganz eine andere Metaphorik aufweist.
Keine bloßen Synonyme
Diese Gegebenheit, dass Bedeutungsspektren sehr komplex und vielschichtig sind, wissen gerade die wertvolleren Autoren sehr geschickt zu nutzen. Schauen wir uns diesen Satz aus der Rede pro Caelio, in der Cicero schreibt:
… quaeram prius utrum me secum severe et graviter et prisce agere malit an remisse et leniter et urbane.
Cic. Cael. 33.
Wir haben offensichtlich einen Parallelismus – utrum Adv. et Adv. et Adv. an Adv. et Adv. et Adv. –, bei dem die zwei parallelen Konstruktionen in antithetischem Verhältnis zueinander stehen, denn severe, graviter und prisce bedeuten alle ’streng‘, während remisse, leniter und urbane alle ‚lässig‘ bedeuten. Warum nutzt Cicero hier also jeweils drei verschiedene Adverbien, um das Gleiche zu sagen?
- severe und remisse bezeichnen allgemein das Verhalten einer Person
- graviter und leniter sind beide Metaphern des Gewichts, die sich auf ähnliche Weise auf den Grad der Strenge beziehen können
- prisce und urbane drücken beide den Grad der Strenge wie nach gegebenen Sitten üblich, nämlich prisce ’streng (wie früher)‘ und urbane ‚lässig (wie in der Stadt üblich)‘
So gesehen ist es völlig klar, dass eine Übersetzung dem Originaltext nicht hundertprozentig gerecht werden kann. Das ist auch nicht das Ziel von Übersetzungen, wie wir im nächsten Beitrag sehen werden.
Nachtrag: Der Artikel ist mittlerweile da! Warum sollte ich das Original lesen, wenn es Übersetzungen gibt?
Mehrschichtige Texte
Oft passiert in lateinischen Texten, dass eine konkrete Wörter aus einem Bereich, wie z.B. der Schifffahrt, im übertragenen Sinne benutzt werden, z.B. um über die Verwaltung des Staates zu sprechen. Dadurch entsteht eine Mehrschichtigkeit, die oft nicht in einer Übersetzung funktionieren.
Bedeutsame Wortabfolge
Wenn es um den Umgang mit der lateinischen Sprache geht, scheinen wir zu vergessen, dass Texte so konzipiert sind, dass sie von links nach rechts rezipiert werden sollen. Die Wortreihenfolge ist im Lateinischen insofern relativ frei, dass die morphosyntaktische Markiertheit vieler Konstituenten unterschiedliche Satzgestaltungsoptionen ermöglicht. Aus demselben Grund ist zum Beispiel die Topologie des Deutschen freier als die des Englischen.
Auch die Topologie des Lateinisches wird gerade in den Fällen, in denen die morphologische Markierung nicht eindeutig ist, weniger frei: So muss im AcI die Reihenfolge Akkusativsubjekt vor Akkusativobjekt unbedingt beibehalten werden, um die Funktionen unterscheiden zu können:
- Brutum Caesarem necavisse – Brutus habe Cäsar umgebracht
- Caesarem Brutum necavisse – Cäsar habe Brutus umgebracht
Insgesamt ist die Topologie des Lateinischen ansonsten verhältnismäßig „frei“. Frei darf aber nicht mit willkürlich verwechselt werden. Sie ist nämlich alles andere als willkürlich, denn die guten Autoren sind in der Lage, die verschiedenen sprachlichen Gestaltungsmöglichkeiten zur Verfolgung ihrer jeweiligen Intention kunstvoll auszunutzen.
Im Betrag Vom Übersetzungsdiktat im Lateinunterricht habe ich bereits das folgende Beispiel angebracht, das ich hier noch einmal vorschlage. Dieses Sueton-Beleg besitzt nämlich dank der morphosyntaktischen Aufbereitung kinematographische Kraft.
Exanimis diffugientibus cunctis aliquamdiu iacuit, donec lecticae impositum, dependente bracchio, tres servoli domum rettulerunt.
Suet. Vitae I,82.
Das Ganze fängt mit exanimis an. In dieser sorgfältig orchestrierten Szene sehen wir zunächst nur den Sterbenden im Vordergrund. Wie in einer kinematographischen Szene erfolgt dann mit diffugientibus cunctis aliquamdiu iacuit ein Dolly-Zoom: Wir sehen jetzt auch, wie alle um Cäsar herum fliehen. Wir sehen auch genau, dass sie sich in verschiedene Richtungen entfernen (diffugientibus), während der noch sichtbare Cäsar da liegt. Dann kommt eine weitere Handlung: donec lecticae impositum. Das Partizip steht im Passiv: In unserer Filmszene sehen wir also bloß, wie Cäser von Armen auf eine Sänfte gelegt wird, während die Handlungsträger für uns Betrachter noch gesichtslos bleiben. Dabei wird bedeutungsvoll auf Cäsers herabhängenden Arm (dependente bracchio) eingezoomt, bis die Handlungsträger (tres servoli) schließlich eingeblendet werden. In der Totale-Einstellung folgen wir diesen schließlich, während sie Cäsars Leiche nach Hause zurückbringen.
Da der Übersetzer den syntaktischen Strukturen der Zielsprache folgen muss, riskieren wir die Kraft solcher Passagen zu verpassen, wenn wir auf die Originallektüre verzichten. Und selbst wenn die Zielsprache die Mittel zur Verfügung stellt, um eine solche Szene nachzuahmen, muss man als Leser das Glück haben, einen sehr guten Übersetzter mit ausreichenden zeitlichen Ressourcen gefunden zu haben, der den Ausgangstext richtig interpretieren und meisterhaft übertragen kann.
Wort- und Klangspiele
Besonders schwierig zu übersetzen sind Wortspiele. Selten hat der Übersetzer das Glück, dass sich ein Wortspiel von dem einen ins andere Sprachsystem übertragen lässt.
(Mouse:) “Stigand, the patriotic archbishop of Canterbury, found it advisable—’ ”
Lewis Carroll, Alice’s Adventures in Wonderland
“Found what?” said the Duck.
“Found it,” the Mouse replied rather crossly: “of course you know what ‘it’ means.”
“I know what ‘it’ means well enough, when I find a thing,” said the Duck: “it’s generally a frog or a worm. The question is, what did the archbishop find?”
Eine Übersetzung ins Deutsche funktioniert an dieser Stelle beispielsweise problemlos: fand es ratsam, wunderbar. Der italienische Übersetzer hat da mehr zu grübeln: trovare ‚finden‘ passt in diesem Kontext nur bedingt und man kann hier kein direktes Pronomen verwenden. Doof.
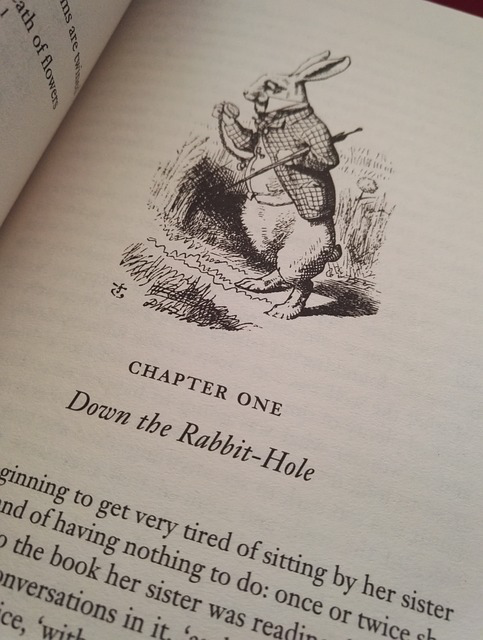
In vielen, je nach Sprachenduo in den meisten Fällen lassen sich Wortspiele nicht übertragen und der Übersetzer muss eine Entscheidung treffen:
- Das Wortspiel geht ersatzlos verloren.
- Das Wortspiel geht an dieser Stelle verloren und der Übersetzer nimmt eine Kompensationsstrategie an einer anderen Stelle vor.
- Das Wortspiel wird in einer Fuß- oder Endnote erklärt. (Diese letzte Option ist ziemlich lästig für den Leser und wird z.B. von Umberto Eco im übersetzungstheoretischen und -analytischen Essay Dire quasi la stessa cosa als „ultima ratio“ erst empfohlen.)
Wenn Sie jetzt denken, dass lateinische Texte eh keine Wortspiele enthalten, lesen Sie den folgenden Abschnitt aus Pontanos Dialog Charon.
Hier erklärt der Pariser Sophist dem Fährmann der Unterwelt, er sei sterblich, denn er sei ja Charo/caro (Charon/Fleisch).
„Morieris, Charon!“ vociferabatur. Ego me, qui de mortalium non essem numero, moriturum negabam; at ille, „Morieris!“ inclamabat. „Quinam hoc fiet?“ inquam. Tum ille distortis superciliis: „Charo“, inquit, „es, omnis autem caro morti est obnoxia, morieris igitur; et cum diutius vixeris, brevi morieris.“
Giovanni Pontano, Charon
Charon lacht sich auch über die nächste Seele kaputt (quam pene risu me confecit!), der behauptet, Charon habe bei sich viele Brüder des Romolus:
„Remus“, inquit, „Romuli frater fuit; plures istic remos habes, plures ergo fratres tecum sunt Romuli.“
Giovanni Pontano, Charon
Und so geht es eine ganze Weile fröhlich weiter. 🙂

Auch Klangspiele und Lautmalereien kann man schwer übersetzen.
Im folgenden Ausschnitt aus Alice im Wunderland ist die Verwechslung zwischen cats und bats zwar inhaltlich erklärt (as she couldn’t answer either question, it didn’t much matter which way she put it), doch nur deswegen wahrscheinlich, weil cats und bats als Minimalpaar ähnlich klingeln. Mit Katzen und Fledermäusen funktioniert die Stelle weniger gut.
“And here Alice began to get rather sleepy, and went on saying to herself, in a dreamy sort of way, “Do cats eat bats? Do cats eat bats?” and sometimes, “Do bats eat cats?” for, you see, as she couldn’t answer either question, it didn’t much matter which way she put it.”
Lewis Carroll, Alice’s Adventures in Wonderland
Schauen wir uns auch diesen Satz von Cicero an, der einer Passage vom de oratore entnommen ist, in der es um die richtige Aussprache geht, die u.a. mit der richtigen Modulation des Luftstroms erzielt werden kann:
nolo verba exiliter exanimata exire, nolo inflata et quasi anhelata gravius.
Cic. de orat. 3.41.
In einer Übersetzung gingen sowohl die Alliteration exiliter/exanimata/exire als auch das Homoioteleuton inflata/anhelata verloren, die doch sehr auffällig zum jeweiligen Inhalt korrespondieren.
Metasprache und kulturelle Hintergründe
“Curiouser and curiouser!” cried Alice (she was so much surprised, that for the moment she quite forgot how to speak good English)”
Lewis Carroll, Alice’s Adventures in Wonderland
Absichtliche Sprachspiele und metasprachliche Anmerkungen stellen eine Herausforderung in der Übersetzung dar und verlieren an Kraft oder gehen verloren.
Wenn Cicero beispielsweise über die korrekte Aussprache, die bessere Wortreihenfolge oder die lateinische Terminologie für philosophische Termini Technici, die er aus dem Griechischen übersetzt, spricht, muss man selbstverständlich das Lateinische vor Augen haben, damit die Anmerkungen Sinn ergeben. Mit einer Übersetzung kommt man nur so weit.
Apropos Metasprache fällt mir eine Szene (ich glaube) aus dem Film The Prince & Me (dt.: Der Prinz & ich) ein, in der jemand sagte: „Maybe he doesn’t understand English.“ Ich hatte mir mal den Spaß gegönnt, nach der deutschen und italienischen Übersetzung zu schauen:
- Deutsch: „Vielleicht versteht er kein Englisch.“
- Italienisch: „Forse non capisce la nostra lingua.“
Man wollte nicht sagen kein Deutsch, denn der Film spielt teilweise in den USA und das ist relevant für den Plot, aber so macht es auch keinen Sinn, denn keiner spricht gerade Englisch.
Die italienische Übersetzung vermeidet es auch von italiano zu sprechen, löst das Problem auf eine Weise, die logisch ist: la nostra lingua ‚unsere Sprache‘.
Im nächsten Beitrag wird es u.a. um die Frage gehen, wie sichtbar ein Übersetzer eigentlich sein darf.
Nachtrag: Der Artikel ist mittlerweile da! Warum sollte ich das Original lesen, wenn es Übersetzungen gibt?
Ich habe mich bei den heutigen Überlegungen auf Prosa beschränkt. Viel mehr könnte man dazu sagen. Noch mehr, wenn man über die Übersetzung von Dichtung sprechen möchte.
Ich wollte bloß zeigen, dass es keine eins-zu-eins-Entsprechungen zwischen Texten geben kann. Der gute Übersetzer muss sich der Bedeutungsnuancen und Konnotationen eines Wortes, eines Satzes und eines Textes in der Ausgangssprache sowie der in Frage kommenden (Teil-)Äquivalenten der Zielsprache bewusst sein, um sich dann für einen Aspekt zu entscheiden. Äußerst selten wird er ein volles Äquivalent in der Zielsprache finden.
Das Bewusstsein darüber, wie viel im Übersetzungsprozess verloren geht, macht es für einen Übersetzer beinahe unerträglich Übersetzungen zu lesen.
Jeden Sonntag erscheint ein neuer Artikel auf der Webseite. Bis der nächste herauskommt, könnten Sie auch diese interessieren:
- 5 Gründe gegen das Latine loqui
- Latein lernen: Seit dieser Antwort liebe ich ChatGPT
- Was ist Bildung? Ausgehend vom Lateinischen
- Altlatein, Mittellatein, Neulatein?
- Goethes Tipps zur Originallektüre
Abonnieren Sie meinen Newsletter!



0 Kommentare