Sprachen sind mein Ding. Aber bin ich wirklich Polyglott?
Im Internet nennen sich viele mehrsprachig, weil sie in Videos 20 Sprachen anreißen: Name, Herkunft, das war’s.
Na, herzlichen Glückwunsch!
Für alle, die wirklich viel Zeit und Energie ins Sprachenlernen investieren, ist das oft frustrierend – und die Reaktionsvideos auf YouTube vermehren sich, gerade wenn das falsche Sprachgenie Viewers mit einem exklusiven Sprachlernprogramm scammen will.
Die Frage stellt sich also: Wann ist es gerechtfertigt, sich polyglott zu nennen?
Ein Blick in die Wörterbücher hilft da nur bedingt weiter. Manche führen das Substantiv Polyglott gar nicht auf. Andere – wie das Duden-Online-Wörterbuch – akzeptieren immerhin die flektierte Substantivierung Polyglotter. Doch wirklich aufschlussreich sind die Bedeutungsangaben nicht.
Die naivste Bedeutung, etwa im DWDS, ist ‚jemand, der viele Sprache spricht‘. Supi: Ich habe ein Problem mit viele, mit Sprachen und mit spricht. Das Einzige, was ich verstehe, ist jemand, der, also ‚einen mit Relativsatz näher definierten Menschen‘.
Das Problem mit Sprachen
Wenn wir Sprachen hören, denken wir meistens an offizielle Amtssprachen, wie Spanisch, Englisch, Französisch. Doch jemand, der mehrsprachig ist, bewegt sich nicht zwingend ausschließlich in diesem Rahmen, sondern spricht vielleicht auch einen Dialekt. Und damit meine ich nicht den Akzent, an dem man einen Kölner erkennt, sondern ein ganzes Sprachsystem mit eigener Phonetik/Phonologie, Morphologie, Syntax usw., das in keinem Land als Amtssprache gilt. Oder wie es treffend heißt: „Ein Dialekt ist eine Sprache ohne Armee.“ Die allerallerallermeisten Dialekte im deutschsprachigen Raum sind leider ausgestorben. In Italien wachsen viele Menschen noch bilingual mit Dialekt und Italienisch als Muttersprachen auf. Obwohl Dialekte auch vollwertige natürliche Sprachen sind, werden sie bei der Frage, ob jemand polyglott ist, meist nicht berücksichtigt.
Es scheinen nur die Sprachen zu zählen, die man im Lebenslauf angibt. Doch selbst das ist kulturell geprägt. So ist es in Deutschland üblich, auch tote Sprachen wie Latein oder Altgriechisch im Lebenslauf aufzulisten, während dies in Italien nur passiert, wenn sie für den Job tatsächlich relevant sind. Ansonsten gelten sie in der allgemeinen Vorstellung eher als logisch-kognitive Übung denn als echte Sprachen. (Darüber könnte ich mich lange aufregen, aber wozu eigentlich?)
Lesen Sie auch: Vom Übersetzungsdiktat im Lateinunterricht.
Was ist schließlich mit Gebärdensprachen? Auch diese sind natürliche Sprachen, denn sie erfüllen folgende Kriterien:
- spontane Entstehung,
- Möglichkeit frühkindlichen Erwerbs,
- verschiedene sprachliche Ebenen,
- kulturelle Verankerung.
Der wesentliche Unterschied neben dem fehlenden Lautsystem ist die starke Überlappung mit der entsprechenden Lautsprache bei Mundbild und Schriftsprache.
Lesen Sie auch Die lateinische Sprache und ich: eine komplizierte Liebesgeschichte.
Das Problem mit spricht
Einige Wörterbücher verwenden in der Definition von Polyglott beherrschen statt sprechen – zu Recht, denn Sprachkompetenz umfasst die vier Teilbereiche Hören, Sprechen, Lesen, Schreiben.
Doch in der öffentlichen Wahrnehmung – insbesondere auf Social Media – liegt der Fokus auf mündlicher Kommunikation. Das liegt wohl an den Videos, die demonstrieren sollen, wie jemand (angeblich) spontan in verschiedenen Sprachen spricht. Dasselbe in schriftlicher Form hätte kaum denselben Effekt. Beim Schreiben würden alle denken, dass ChatGPT am Werk war. Und wer Bücher in sechs Sprachen liest, geht allen am Wertesten vorbei.
Ist das Primat des Sprechens gerechtfertigt? Meiner Meinung nach nicht.
Zwar ist ein Video mit einem spontanen Dialog der glaubwürdigste Weg, Sprachkenntnisse zur Schau zu stellen, aber Sprache dient immer der Kommunikation, der Übermittlung einer Botschaft. Das passiert nicht nur im Gespräch, sondern auch beim Lesen, Schreiben oder Vortragen.
Die Motivation, eine Sprache zu lernen, geht aus diesem Grund oft weit über den bloßen Dialog hinaus. Meine eigenen sprachlichen Kompetenzen sind im schriftlich-rezeptiven Bereich besonders stark – nicht weil ich gezielt darauf hinarbeite, sondern weil ich viel und, wenn möglich, immer im Original lese. Das stärkt natürlich genau diesen Bereich.
Auch das monologische Sprechen ist mir persönlich extrem wichtig. Ich bin nämlich Freie Rednerin und biete mehrsprachige Zeremonien an. Dank KI-Tools kann ich Reden auch in Sprachen halten, die ich nicht auf muttersprachlichem Niveau beherrsche. Fehler glätten, komplexe Passagen übersetzen – all das erlaubt mir, in mehreren Sprachen stilvoll aufzutreten, selbst wenn ich sie nur auf B2-Niveau beherrsche.
Manche Menschen wiederum schreiben wissenschaftlich auf hohem Niveau, können aber kaum frei sprechen. Wieder andere wollen vor allem Filme oder Serien verstehen.
Kurz: Sprachkompetenz verteilt sich individuell unterschiedlich. Warum sollte man sich bei der Selbstbeurteilung, ob man polyglott ist oder nicht, auf dialogische Kompetenz beschränken?
„Sollte ich Job wechseln?!“ – In 90 Minuten zur Antwort! Laden Sie den WEGweiser kostenlos herunter:
Das Problem mit vielen
Polyglott: πολύς ‚viel‘ + γλῶσσα ‚Sprache‘ → viele Sprachen …
Tja, wie viele sind viele?
3? 4? 5? 10?
Wir tasten uns mal ran:
- Eine? Sicher nicht.
- Zwei? Das wäre ein bilingualer Mensch (wobei sich das Wort bilingual in aller Regel auf muttersprachliche Verhältnisse und weniger auf Sprachlerner bezieht).
- Drei? Immer noch zu wenig.
Das Problem mit relativen Adjektiven ist immer ihr Bezugspunkt. Was ist größer: eine riesengroße Maus oder ein winziger Elefant? Viele heißt eben nur ‚mehr, als man in einem bestimmten Kontext erwartet‘. Wenn ich ins Esszimmer unseres Drei-Personen-Haushalts komme und rufe: „Wow, das sind aber viele Brötchen!“, liegen vielleicht acht im Brotkorb. Bei acht Blumen in einer Vase würde ich dasselbe wohl kaum sagen.
Und bei Sprachen? Sind drei viele? Für den Durchschnitt vielleicht – aber angesichts dessen, was der Begriff polyglott suggeriert, finde ich: nein. - 4? Da kommt schon etwas zusammen, aber genug, um von viel zu sprechen?
- Ab 5 I’m sold! Mit 5+ gut beherrschten Sprachen darf man sich polyglott nennen.
Was heißt aber gut beherrschen?
Die Frage nach dem Niveau
Selbst wenn wir festlegen, welche Sprachen „zählen“ und wie viele es sein müssen und welche Teilkompetenzen berücksichtig werden sollen – welches Niveau reicht aus?
Zu viele nennen sich polyglott, weil sie Hallo! Wie geht’s? in zig Sprachen sagen können. Dann gibt es professionelle Polyglotte, wie der Inder aus Tamil Nadu, der angeblich mit 19 bereits 400 (!) Sprachen gelernt hat. Davon soll er 46 Sprachen fließend sprechen. Klar…
Bei später erlernter Mehrsprachigkeit ist eine Asymmetrie unvermeidbar. Die Frage nach dem Niveau kläre ich mit der Kommunikationsfähigkeit. Daher reicht alles im A1- oder A2-Bereich nicht aus. Auch B1 ist zu wenig, wie ich aus meiner Erfahrung mit Französisch weiß. B2, also selbstständige Sprachverwendung, sollte es mindestens sein:
Kann die Hauptinhalte komplexer Texte zu konkreten und abstrakten Themen verstehen; versteht im eigenen Spezialgebiet auch Fachdiskussionen. Kann sich so spontan und fließend verständigen, dass ein normales Gespräch mit Muttersprachlern ohne größere Anstrengung auf beiden Seiten gut möglich ist. Kann sich zu einem breiten Themenspektrum klar und detailliert ausdrücken, einen Standpunkt zu einer aktuellen Frage erläutern und die Vor- und Nachteile verschiedener Möglichkeiten angeben.
https://www.europaeischer-referenzrahmen.de
Mir bleibt nur ein großer Zweifel: Wenn wir das genau nehmen, sind viele Menschen nach dieser Logik nicht einmal monolingual… 😢
Aber gut! Unabhängig von Anzahl und Niveau zählt am Ende doch vor allem, was man mit den eigenen Sprachen macht. Sprachen sind schließlich kein Panini-Album zum Angeben! Sie wollen erlebt, benutzt und geteilt werden.
Und Sie?
Nennen Sie sich polyglott?
Auch nach dieser Definition – 5 Sprachen, mindestens B2-Niveau?
Was ist die Sprache, die Sie am meisten begeistert?
Und welche stehen noch auf der Wunschliste?
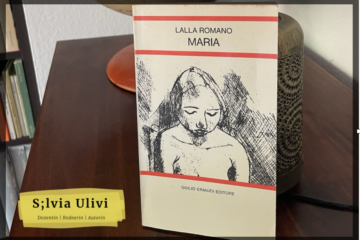

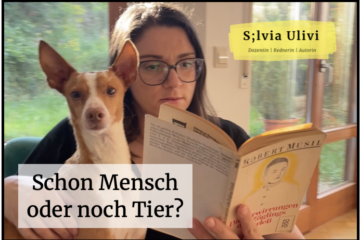
0 Kommentare